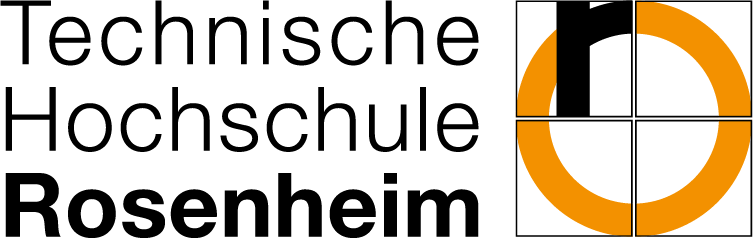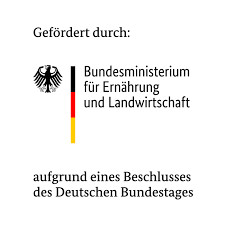Verbundvorhaben: Rettung von Großvieh bei Brandereignissen landwirtschaftlicher Gebäude in Holzbauweise; Teilvorhaben 1: Bauliche und konstruktive Grundlagen
Innerhalb des Teilvorhabens 1 des Verbundprojektes wurde ein Beitrag zu den baulichen und konstruktiven Grundlagen einer effektiven Rettung von Großvieh bei Brandereignissen erstellt und Möglichkeiten einer effektiven Brandfrüherkennung sowie Vorschläge für bauliche Maßnahmen erarbeitet. Unter Beachtung vorhandenen Betriebsstrukturen und der nutztierartabhängigen, tierphysiologischen Aspekte wurden Vorschläge für konstruktive und bauliche Durchbildungen von baulichen Anlagen zur Verbesserung einer effektiven Rettung und Nachbetreuung von Großvieh, insbesondere in der Entstehungsphase von Brandereignissen, erarbeitet.
Hintergrund des Projekts
Bedingt durch die wirtschaftliche Entwicklung der Landwirtschaft von kleinstrukturierten Betrieben hin zu industrieähnlichen Großerzeugern landwirtschaftlicher Produkte sind einhergehend auch Anpassungen der Gebäudegröße maßgebend. Dabei werden sowohl durch politische, wirtschaftliche und tierökologische Rahmenbedingungen, aber auch durch ein geändertes Verbraucherverhalten, bei Um- und Neubauten ausschließlich Laufstallungen errichtet. Allerdings werden, bedingt durch den hohen Platzverbrauch der Bauform je Großvieheinheit, in Kombination mit dem wirtschaftlichen Erfordernis von Betriebsvergrößerungen, immer größere Stallgebäude benötigt.
Bedingt durch eine optimale Ablaufplanung in der Stallplanung sind hierbei möglichst große Flächen ohne brandschutztechnische Trennung nötig. Demgegenüber stehen die Forderungen der Landesbauordnungen und Versicherungsträger nach einer brandschutztechnisch wirksamen Unterteilung in einzelne Brandabschnitte, wobei allerdings unterschiedliche Schutzziele verfolgt werden. Der Gesetzgeber auf der einen Seite stellt als primäres Ziel die Rettung von Mensch und Tier in den Vordergrund, Versicherungsträger auf der anderen Seite sehen als primäres Ziel des (baulichen) Brandschutzes die Schadensbegrenzung an den Gebäuden, was sich auch in den Versicherungsleistungen widerspiegelt. Im Brandschadensfall sind in der Regel die Schäden an Gebäuden mehr oder weniger gedeckt, der Schaden durch den Verlust von Tieren und somit der Produktionsgrundlage des Betriebes ist, wenn überhaupt, nur marginal abgedeckt.
Hier setzt das Projekt REGROBRA an. Durch die Entwicklung eines übergreifenden Konzeptes zur Tierrettung, das sowohl bauliche, anlagentechnische als auch organisatorische Maßnahmen verknüpft, soll der Schaden durch den Verlust von Tieren aufgrund mangelnder Rettungsmöglichkeit begrenzt oder verhindert werden. Neben der Umsetzung von baulichen Maßnahmen, wie der Schaffung von gesicherten Fluchtkorridoren mit geringer Brandlast, welche in Kombination mit anlagentechnischen Maßnahmen im Brandfall die Fluchtmöglichkeit für einen begrenzten Zeitraum ermöglichen, sollen hierbei die Bewegungsabläufe der Tiere im Tagesablauf mit dem Verhaltensmuster im Brandfall abgestimmt werden und in entsprechende Konzepte integriert werden. Vor allem das kalkulierbare Brandverhalten von Holz kann hierbei bei der Ausbildung eines Korridorkonzeptes einen entscheidenden Vorteil bringen.
Das Korridorkonzept wird durch einen innovativen Ansatz der Fluchtwegöffnung ins freie im Rahmen des anlagentechnischen Brandschutzes ergänzt. Diese können im Brandfall durch die Feuerwehr geöffnet werden, um den Tieren eine ungehinderte Fluchtmöglichkeit aus dem angestammten Bereich zu ermöglichen. Allerdings sind diese Ansätze ausschließlich von einer frühzeitigem Alarmierung im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes abhängig. REGROBRA integriert diese Methode in den Korridoransatz und verknüpft dabei bekannte Methoden der Rauch- und Branderkennung mit robusten, automatischen Öffnungsmechanismen in den Fluchtkorridoren.
Projektziel
Durch die Entwicklung eines Evakuierungskonzeptes für Großvieh bei Brandereignissen in landwirtschaftlichen Stallungen in Holzbauweise durch eine Kombination aus anlagentechnischem, organisatorischem und baulichem Brandschutz trägt das Projekt im Rahmen der Entwicklung neuer Technologien und integrierter Nutzungskonzepte direkt zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Landwirtschaft bei. Durch eine effektive Tierrettung kann sowohl der durch das Ereignis entstandene direkte Schaden an den Tieren vermindert werden, als auch die Entwicklungs- und Zuchtarbeit der Bewirtschafter an der Herde vor Totalverlust bewahrt werden, welche zumeist mit marktüblichen Entschädigungszahlungen nicht zu ersetzen ist.
Da für eine funktionierende Rettung der Erhalt der Tragfähigkeit während des Brandereignisses, eine Sicherstellung entsprechender Fluchtmöglichkeiten, eine entsprechende Abfuhr tödlicher Rauchgase sowie eine Schulung des Rettungspersonals im Umgang mit den Tieren von entscheidender Bedeutung ist, kann bei entsprechender baulichen Durchbildung der Konstruktion eine herausragende Eigenschaft des Baustoffes Holz zielführend eingesetzt werden. Im Gegensatz zu Beton oder Stahl bietet der Baustoff Holz im Brandfall den entscheidenden Vorteil der Mobilisierung von Resttragfähigkeiten im Brandfall in Kombination mit der Ausbildung einer Schutzschicht aus Kohle, wodurch bei entsprechender baulichen Durchbildung Fluchtwege und Fluchtkonstruktionen der Tiere entsprechend gegen Tragwerksversagen geschützt werden können.
Kalkulierbare Resttragfähigkeit einer Holzkonstruktion sowie die Möglichkeit der regionalen Produktion und Fertigung bieten die optimale Grundlage zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, insbesondere im ländlichen Raum, wodurch ein Beitrag zur nachhaltigen Erzeugung und Bereitstellung nachwachsender Ressourcen geleistet wird.
Partnerschaften
Die Technische Hochschule Rosenheim erarbeitete in enger Zusammenarbeit mit den Projektpartnern Präventionsingenieure e.V. und Hochschule Weihenstephan-Triesdorf einen interdisziplinären Ansatz der Erarbeitung von Evakuierungskonzepten von Milchkühen bei Brandereignissen, welches neben vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen stark auf die Berücksichtigung organisatorischer Maßnahmen ausgerichtet ist und dabei tierphysiologische Verhaltensbesonderheiten eine große Rolle spielen. Durch die Zusammenarbeit mit dem projektbegleitenden Beirat Haas Fertigbau GmbH und landplan.bayern GmbH & Co. KG flossen die umfassenden Erfahrungen aus der täglichen Praxis in die Konzeptfindung mit ein.
Projektleitung
T +49 (0) 8031 / 805 - 2477 Sebastian.Hirschmueller[at]th-rosenheim.de
ORCID iD: 0000-0002-1135-8732
Projektmitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Projektdauer
01.05.2020 - 31.12.2022Projektpartner
Projektträger

Projektförderung