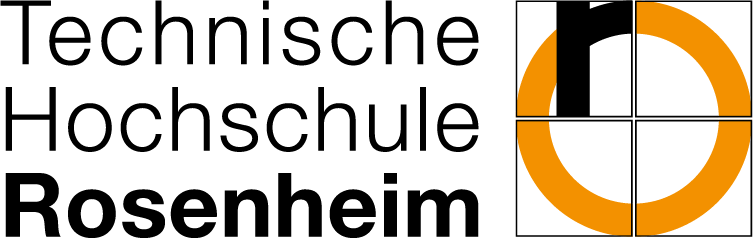WisKHa.dual: Wissen - Können - Haltung - Befragung Studierender zur Kompetenzentwicklung in dualen und vollzeitregulären Studienformaten der Sozialen Arbeit
Projektziel ist, die Entwicklung bzw. Aneignung von Wissen, Können und Haltung in verschiedenen Studienformaten der Sozialen Arbeit bei verschiedenen Anbieter*innen systematisch in den Blick zu nehmen. Nachgegangen werden soll der Frage, ob sich Ausprägungen von Wissensbeständen, Kompetenzen und Haltungen, des Belastungserlebens, der Relationierung von Theorie und Praxis und der Bindung an einen aktuellen Arbeitgeber bei Studierenden der Sozialen Arbeit eines generalistisch ausgerichteten Bachelorstudiums nach Studienformat unterscheiden.
Hintergrund des Projekts
Träger der Sozialen Arbeit stehen seit geraumer Zeit vor der Herausforderung, Fachkräfte nicht nur gewinnen, sondern auch halten zu müssen. Hohe Fluktuation unter den Mitarbeiter*innen bei gleichzeitigem quantitativen Mangel an Fachkräften führen dazu, dass freiwerdende Stellen teilweise lange nicht nachbesetzt werden können. Vor dem Hintergrund des beginnenden Renteneintritts der geburtenstarken Jahrgänge wird sich die Situation noch weiter verschärfen. Organisationen der Sozialen Arbeit beschäftigt daher schon länger die Frage, wie neue Mitarbeitende gewonnen und auch gehalten werden können.
Die Profession und einzelne Vertreter*innen der Disziplin Soziale Arbeit erachten das praxisintegrierende duale Studium mittlerweile als ein zentrales Instrument zur Fachkräftegewinnung und -sicherung. Das duale Studium Soziale Arbeit erfreut sich dabei auch zunehmender Beliebtheit auf Träger- und Studierendenseite.
Momentan wird der wachsende Fachkräftebedarf überwiegend von privaten Studienanbietern abgedeckt. Zu erklären ist dies vor allem damit, dass das Studienformat dual in der Disziplin Sozialer Arbeit teilweise mit großer Skepsis betrachtet wird und staatliche Hochschulen sehr zurückhaltend dabei sind, neben einem regulären Vollzeit- oder Teilzeitstudiengang ein duales Angebot einzurichten.
Vor dem Hintergrund, dass Studieninhalte teilweise funktional und einseitig auf die spezialisierten Bedarfe einzelner Handlungsfelder oder gar Arbeitgeber zugeschnitten wurden bzw. werden (in die Kritik geraten sind hierbei u.a. Kooperationsvorhaben der Städte München und Hamburg mit privaten Anbietern), ist eine kritische Beobachtung auch verständlich.
In Bezug auf diese Kritik gegenüber dualen Studienformaten zeigt sich interessanterweise, dass die in der Wissenschaft Soziale Arbeit geführte Diskussion um die Chancen und Grenzen verschiedener Studienformate des Studiengangs Soziale Arbeit aktuell rein theorie- bzw. ideologiegeleitet erfolgt und ein Einbezug empirischer Erkenntnisse fehlt. Zu konstatieren ist hierbei, dass die Studienlage zum dualen Studium Soziale Arbeit aktuell noch sehr dünn ausfällt.
Projektziel
Im Rahmen des Projektes soll der Frage nachgegangen werden, ob sich Unterschiede in den Ausprägungen von Wissensbeständen, Kompetenzen und Haltungen, des Belastungserlebens, der Relationierung von Theorie und Praxis und der Bindung an einen aktuellen Arbeitgeber bei Studierenden der Sozialen Arbeit eines generalistisch ausgerichteten Bachelorstudiums nach Studienformat unterscheiden.
Ziel dabei ist, die Entwicklung bzw. Aneignung von Wissen, Können und Haltung in verschiedenen Studienformaten der Sozialen Arbeit bei verschiedenen Anbieter*innen systematisch in den Blick zu nehmen.
Projektablauf
Im Verlauf des Projekts werden Studierende und Absolvierende der Sozialen Arbeit in den Formaten dual und vollzeitregulär an der TH Rosenheim, der HS Augsburg und der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf sowie weiterer kooperierender Hochschulen im Wintersemester 2022/23 mit einem quantitativen Online-Fragebogen befragt.
- Konzipierung und Pretest des quantitativen Befragungsinstruments
- Streuung des Befragungsinstruments unter Studierenden der THRO, HSA, FFH und weiterer Kooperationspartner
- Statistische Analyse der erhobenen Daten
- Verschriftlichung der Ergebnisse in einem Forschungsbericht sowie Veröffentlichung in einschlägigen Fachjournals bzw. Präsentation auf Fachtagungen
- Konzipierung und Formulierung von Folge-Vollanträgen, z.B. BMBF-Förderrichtlinie FH Kooperativ und HBS-Forschungsschwerpunkt Bildung in der Arbeitswelt
Innovation
Eine Untersuchung möglicher Unterschiede in den Bereichen Wissen, Können und Haltung, Belastungserleben, Verzahnung von Theorie und Praxis sowie Zufriedenheit mit und Bindung an einen aktuellen Arbeitgeber bei Studierenden und Alumni der Sozialen Arbeit nach Studienformat (vollzeitregulär, dual und berufsintegrierend) haben bislang nur Emmerich und Linßer (2022) realisiert. Einschränkend ist festzustellen, dass hier die Stichprobe nur aus Studierenden eines Hochschulstandorts gezogen wurde. Aufgrund einer geringen Gruppengröße in den einzelnen Formaten konnten auch keine inferenzstatistischen Analysen vorgenommen werden und die Ergebnisdarstellung erfolgte rein deskriptiv.
Festzuhalten ist daher, dass insgesamt Untersuchungen fehlen, die die Entwicklung bzw. Aneignung von Wissen, Können und Haltung in verschiedenen Studienformaten der Sozialen Arbeit bei verschiedenen Anbieter*innen (staatlich, konfessionell ausgerichtet, privat-gewerblich) systematisch in den Blick nehmen. Diesem Forschungsdesiderat soll mit dieser Studie begegnet werden.
Ausgehend von den zu erwartenden Ergebnissen der hier skizzierten Vorstudie werden weitere empiriegestütze Erkenntnisse dringend benötigt, um die Diskussion über Chancen und Herausforderungen dualer Studiengänge der Sozialen Arbeit datengestützt führen zu können.
Projektleitung
T +49 (0) 8031 / 805 - 4518 Edeltraud.Botzum[at]th-rosenheim.de
ORCID iD: 0009-0006-5688-9453
Projektmitwirkung extern
Projektdauer
01.10.2022 - 30.09.2023Projektpartner
Projektförderung

Förderprogramm
Anschubfinanzierung_internWeblinks
WisKHa.dual auf der Messe ConSozialOnlinetagung Herausforderungen im dualen Studium der Sozialen Arbeit